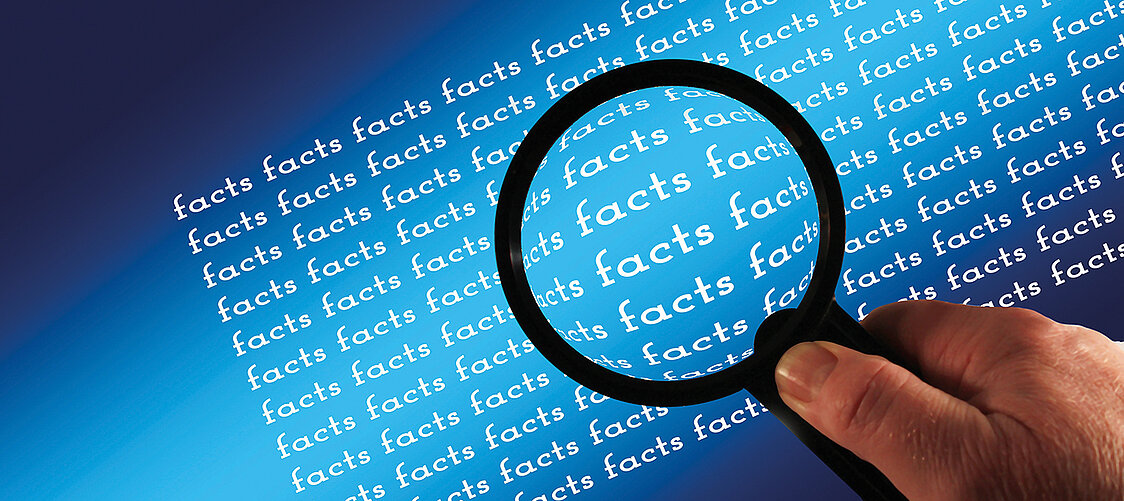- Fachbeitrag
ESG-Risiken sicher offenlegen: Praxistipps zu Artikel 449a CRR
Das Omnibus-Paket der EU
Erste Schätzungen gehen von Milliardenbeträgen aus, die Wirtschaft und Finanzsektor dadurch einsparen könnten – wenn die Vereinfachungen auch in der Praxis greifen. Noch laufen die politischen Verhandlungen, doch die Richtung scheint gesetzt: weg von der reinen Bürokratie, hin zu einem stärkeren Fokus auf das Wesentliche.
Allerdings gilt: Weniger Berichtspflichten in der Realwirtschaft bedeuten nicht automatisch weniger Anforderungen für Banken, Versicherer oder Investoren. Denn parallel bleiben die aufsichtlichen Offenlegungspflichten bestehen – etwa nach Artikel 449a der Kapitaladäquanzverordnung (CRR), die Institute zu detaillierten ESG-Offenlegungen verpflichtet. Damit entsteht eine Schere: Einerseits weniger standardisierte Daten aus der Wirtschaft, andererseits ungebremste Nachfrage nach genau diesen Informationen für Risikoberichte und regulatorische Transparenz. Genau hier setzt die Kritik der BaFin an. Die deutsche Finanzaufsicht fordert, dass Vereinfachungen in der CSRD oder der Taxonomie-Verordnung auch in den aufsichtlichen Offenlegungspflichten nachvollzogen werden. Sonst drohe der Entlastungseffekt zu verpuffen, weil Institute die fehlenden Daten dennoch aufwendig selbst beschaffen müssten.
Zugleich rückt die Kohärenz zwischen zwei zentralen Planungsinstrumenten in den Vordergrund: dem Transitionsplan einerseits, also der strategischen Roadmap eines Unternehmens hin zu Dekarbonisierung, resilienten Lieferketten und nachhaltigen Investitionen, und dem ESG-Risikoplan andererseits, der vor allem aus Sicht der Aufsicht relevant ist. Während Transitionspläne Ziele und Meilensteine festlegen, konzentrieren sich Risikopläne auf die Identifikation, Messung und Steuerung von ESG-Risiken – von physischen Klimarisiken über regulatorische Übergangsrisiken bis hin zu sozialen oder Governance-bezogenen Faktoren. Beide Planarten beruhen jedoch auf denselben Grundbausteinen: Szenarien, KPIs, Dateninventare. Bisher existieren sie häufig nebeneinander, ohne dass eine direkte Verzahnung besteht. Die Aufsicht fordert nun, dass diese Welten zusammengeführt werden: eine gemeinsame Datenbasis, einheitliche Kennzahlen und abgestimmte Szenarien sollen Doppelarbeit vermeiden und die Glaubwürdigkeit stärken.
Ein weiteres Problem liegt in den Zeitplänen. Die Einführung der CSRD wurde in Teilen verschoben („Stop-the-clock“), während die Offenlegungspflichten nach CRR und Pillar 3 planmäßig weiterlaufen. Für Banken bedeutet das: Sie müssen schon jetzt detaillierte ESG-Daten offenlegen, auch wenn ihre Kundenunternehmen diese nach CSRD noch gar nicht verpflichtend erheben. Dadurch entstehen Lücken, die Institute mit Proxy-Modellen, Drittanbieterinformationen oder öffentlichen Daten schließen müssen. Um die Belastung abzufedern, hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) sogenannte „No-Action-Letters“ veröffentlicht – Übergangshinweise, die Rechts- und Planungssicherheit geben sollen. Diese schaffen zwar kurzfristig Luft, ersetzen aber nicht die Notwendigkeit, Strukturen und Prozesse rechtzeitig aufzubauen. Denn spätestens Ende 2025 treten weitere Stichtage in Kraft, etwa für die Green Asset Ratio oder das Banking Book Taxonomy Alignment Ratio.
Für die Praxis ergibt sich daraus ein klarer Handlungsauftrag. Unternehmen und Institute müssen ein zentrales ESG-Dateninventar aufbauen, das verschiedene Quellen integriert: Primärdaten aus eigenen Messungen oder Lieferantenangaben, Sekundärdaten aus öffentlichen Quellen sowie Modelle und Schätzungen. Qualität und Unsicherheit sind dabei transparent zu dokumentieren. Auf dieser Basis lassen sich sowohl Transitionspläne mit ihren Zielpfaden und Investitionsstrategien entwickeln als auch Risikopläne mit Stresstests, Limits und Frühwarnindikatoren. Entscheidend ist, dass beide Planungslogiken auf denselben Parametern beruhen – etwa gemeinsamen CO2-Preisszenarien oder synchronisierten makroökonomischen Annahmen.
Auch die Governance spielt eine wichtige Rolle. Die Aufsicht empfiehlt, ESG-Themen auf höchster Ebene zu verankern – in einem Steuerkreis, der CFO, CRO, CSO und weitere Schlüsselrollen einbindet. Schwellenwerte und Nachhaltigkeitsziele müssen in Kredit- und Investitionsrichtlinien übersetzt werden, sodass sie konkrete Wirkung entfalten. Gleichzeitig verlangt die Regulierung eine modulare Offenlegung: Reporting-Bausteine, die einmal aufgebaut werden und dann für unterschiedliche Zwecke – CSRD, CRR, Taxonomie oder SFDR – genutzt werden können. So lässt sich ein „Single Source of Truth“ schaffen, das konsistente Datenflüsse garantiert und Prüfungen standhält.
Eine besondere Herausforderung stellt der Umgang mit KMU dar. Viele kleinere Unternehmen werden durch das Omnibus-Paket von der Pflichtberichterstattung befreit. Banken und Investoren dürfen diese Lücke aber nicht einfach mit generischen Fragebögen füllen. Stattdessen sollen Daten gezielt und nur bei klarer Relevanz abgefragt werden – abhängig von Branche, Standort oder Exponierung. Andernfalls droht eine Überlastung der KMU und damit ein Verlust an Akzeptanz. Die BaFin betont hier den Grundsatz der Proportionalität: Zuerst auf öffentliche Quellen und Drittanbieterdaten zurückgreifen, nur im Ausnahmefall
direkt anfragen.
Der Text ist eine Zusammenfassung eines Fachartikels
der S&P Unternehmerforum GmbH.